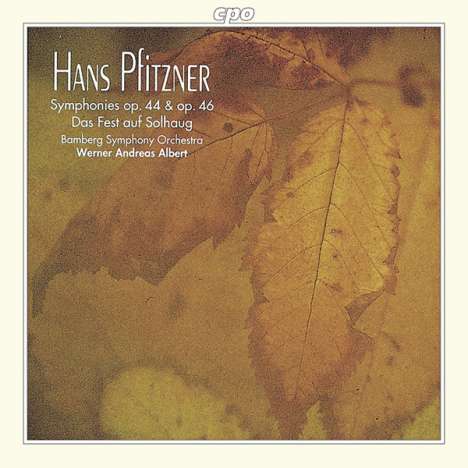Hans Pfitzner: Orchesterwerke Vol.2 auf CD
Orchesterwerke Vol.2
CD
CD (Compact Disc)
Herkömmliche CD, die mit allen CD-Playern und Computerlaufwerken, aber auch mit den meisten SACD- oder Multiplayern abspielbar ist.
Derzeit nicht erhältlich.
Lassen Sie sich über unseren eCourier benachrichtigen, falls das Produkt bestellt werden kann.
Lassen Sie sich über unseren eCourier benachrichtigen, falls das Produkt bestellt werden kann.
- Symphonie op. 44; Symphonie op. 46; Solhaug-Vorspiele Nr. 1-3
- Künstler:
- Bamberger Symphoniker, Werner Andreas Albert
- Label:
- CPO
- Aufnahmejahr ca.:
- 89/90
- UPC/EAN:
- 0761203908028
- Erscheinungstermin:
- 1.5.1998
Für das romantisch-märchenhafte
Schauspiel "Das Fest auf Solhaug" von
Henrik lbsen schreibt Hans Pfitzner in
den Jahren 1889 bis 1890 eine Bühnenmusik.
Und wäre es nicht noch hin bis zu
jenem markanten Datum, da 1895 in Paris
der erste Filmstreifen einer verwunderten
Öffentlichkeit vorgeführt wurde,
so könnte man sagen: Hans Pfitzner hat
eine erstaunlich passende Kinematographen-
Musik erfunden. Nun mag der Vergleich
mit der später in Mode geratenen
Kinotheken-Musik hinken; schließlich
steht Pfitzner in guter Tradition, die von
Beethoven über Schubert, Schumann,
Mendelssohn, Wolf, Berlioz bis hin zu
Debussy, Busoni, Honegger und Kurt
Weill reicht. Und im Jahre 1890 - Pfitzner
ist ein junger Mann von 21 Jahren, Student
noch in Frankfurt - ist das Genre der
Bühnenmusik bereits dermaßen etabliert,
dass die spätere Komposition für
den Film nichts eigentlich Neues zu erfinden
brauchte: als psychologische Vertiefung
der sichtbaren Aktion, als deskriptiv-illustratives
Beiwerk zum szenischen Geschehen,
als klingende Versinnlichung
des auf der Bühne vorgeführten Gestus
war die Bühnenmusik im Verlaufe des 19.
Jahrhunderts ein entwickeltes Medium,
das der schauspielerischen bzw. sprachlichen
Mitteilung eine sensorische Qualität
beifügte. Und doch mag der Seitenblick
auf die spätere Musik im Kino hier
nicht fehl am Platze sein, denn Hans
Pfitzners Musik, auch die spätere der
Sinfonien op. 44 und op. 46, zeigt einen
merkwürdigen Hang zur Unselbständigkeit
so, als könne sie der optischen Zutat
nicht entraten. Dieser Hang ist bereits in
der Bühnenmusik zum lbsen-Schauspiel
auffällig. Man nehme Beethovens Musik
zu Collins "Coriolan" zum Vergleich:
dessen Musik versteht sich nicht als platte
Verdopplung von Stimmung und Gebärde,
sondern bewahrt sich ihre Autonomie
dadurch, dass sie im Konfliktmodell
der Sonatenhauptsatzform ein diskursives
Aquivalent ausformt; die dramatische
Gegensätzlichkeit im Schauspiel
findet in der dramatischen Widersprüchlichkeit
einer höchst eigenständigen Musik
ihre gedankliche (nicht illustrative)
Transposition. Anders bei Pfitzner: er
schreibt Stimmungsbilder und bleibt damit
den szenischen Bildern, Stimmungen
und Tableaus gehorsam auf den Hacken.
Er schreibt mit anderen Worten eine Programmmusik,
die ohne Kenntnis des Programms
(der Handlung) brüchig wäre.
Folgerichtig ordnet der Stuttgarter Verlag
Luckardt in seiner Partiturausgabe von
1903 das Titelbild als Hörwegweiser
durch die dreiteilige Suite an: "Zum Abdruck
auf Programm" . Und
damit hat man den Schlüssel in der Hand
für eine Musik, die sich enträtselt als klingender
Katalog einer "romantischen Figurenlehre"
entsprechend der Kinotheken-
Sammlung, welche Erdmann und
Becce 1927 herausgegeben haben: die
Freiheitssehnsucht der im Reich des
Bergkönigs gefangenen Margit formuliert
sich als motivisch auswegloses Tasten,
der Blick auf den Frühling klingt prompt
in punktierter 6 / 8-Gestalt, als typisiertes
"Siciliano", durchbrechende Sehnsucht
artikuliert sich durch Tempobeschleunigung,
Satzverdichtung, Motivhäufung
und -verknüpfung, bis endlich das "Bergkönig"-Thema imposant-strahlend erscheint. Jetzt
versteht man auch, woher das Eingangsmotiv
(das Motiv der Sehnsucht) kommt:
es ist eine Umkehrung eben dieses Themas,
es ist also eine durch die Bergkönig-
Gefangenschaft begründete Gefühlsqualität.
Die gleiche 1: 1 Abbildung
im zweiten Suitensatz: die verschiedenen
Bilder von Festlichkeit und Tanz
übersetzt der junge Pfitzner mit Tanzfiguren
unterschiedlichen Tempos. Und der
Beginn des dritten Teils - dem Teil der Fieberträume,
Phantasmagorien und des
schließlichen Erwachens - zitiert geradezu
folgerichtig noch einmal das "Bergkönig"-Thema in flüchtigen Konturen, verfährt
im übrigen nach der Handlungsvorgabe
"Durch Nacht zum Licht".
Programmmusik, die sich mit dem Inhaltsfahrplan
in der Hand lückenlos erklärt, die
indessen ohne jenen Handlungsfaden einer
inneren Logik entbehrt. Ohne ihn wären
Stimmungsumschwünge, motivische
Korrespondenzen und diverse Tanzgesten
wenig plausibel; und ohne ihn hätte
die "Solhaug"-Suite auch nicht jene formale
Konsistenz, die bei geglückten Programm-
Kompositionen dazu führt, dass
die Werke auch ohne den programmatischen
Bezug ein in sich geschlossenes
Ganzes darstellen - hier darf man ohne
Schamröte getrost auf Smetanas "Moldau"
verweisen. Pfitzners Suite bliebe
hingegen, was sie infolge ihrer strikten
Verknüpfung mit dem Bühnen-Sujet tatsächlich ist: eine Suite, eine Abfolge von
Stimmungs-Stationen und tänzerischen
Gesten. Das rückt sie nun mal mehr in
die Nähe der Filmmusik denn in die Nähe
einer emanzipierten Bühnenmusik; das
bedingt auch ihren merkwürdigen tautologischen
Charakter. Erdmann und Becce
nannten das sehr zutreffend "Expressionsmusik".
Wir überspringen 50 Jahre. 1939 schreibt Hans Pfitzner die "Kleine Sinfonie" in vier Sätzen op. 44. Hat sich an seiner Handschrift etwas verändert? Steht auch mit der ein Jahr später geschriebenen Sinfonie für großes Orchester op. 46 (1940) ein neuer Hans Pfitzner vor Augen und Ohren? Ja und nein. Ja insofern, als sich das Satzbild der "Kleinen Sinfonie" weit schlanker und durchsichtiger darstellt als in der farbendurchdränkten Bühnenmusik. Der Streicher-Chor klingt nun homogener, die Bläserstimmen, vor allem die Holzbläser-Register, werden solistisch beigemischt und klingen manierlich abgehoben. Homogenität auch in der Konzeption von Themen und Gegenthemen: das Kopfthema des ersten Satzes ist bestimmt von der rhythmischen Figur, welche im Seitenthema ebenfalls wiederkehrt. Haupt- und Nebeneinfall unterscheiden sich nicht substanziell, sondern nur farblich: das erste Thema gehört den Streichern, das zweite den Bläsern. Was wird daraus? Keine Diskussion. keine widersprüchliche Auseinandersetzung, sondern ein einheitlicher Grundzug des musikalischen Charakters, was durch die allmähliche Vorbereitung des nächstfolgenden Themas in der vorhergehenden Überleitung unterstrichen wird. Folgt eine Reprise, die keine ist, sondern nur noch einmal den alles bestimmenden thematischen Grundeinfall in Erinnerung bringt. lm Tonfall und in der auf Annäherung bedachten thematischen Arbeit, die den Kontrast. den expressiven Bruch und den rhetorischen Widerspruch tunlichst vermeidet, entsteht der Eindruck einer friedlichen Idylle, eines gemütvoll-gemütlichen Musizierens; alles ist auf Fluss, auf harmonisches Wechselspiel eingestellt, jede Phrase gibt der anderen sozusagen die freundliche Hand. Dieser Eindruck bleibt bestehen. lm zweiten Satz, einem 6 / 8-Takt-Scherzo, dominiert ein prägnantes Trompeten-Signal. dominieren energische, oft unisono geführte rasche Skalenbewegungen auf- und abwärts. Ein sangliches Gegenthema will sich behaupten, bleibt allerdings ohne Gewicht. Was vordringt, ist unbekümmerte Mendelssohn- Leichtigkeit, ähnlich dem Scherzo für Orchester aus dem Jahre 1988. Und wieder diese beharrlich-leichtfüßige Rhythmusfigur die an den ersten Satz erinnert. Der Satz schließt, wie das für Pfitzner typisch ist, mit einer kurzen Kadenz, die in den elegischen dritten Satz mündet. Den friedvollen Ton stiftet ein dicht gewebter Streicher-Chor, den ein Thema beherrscht, das entfernt an das vierte der "Vier letzten Lieder" von Richard Strauss erinnert. Dieses kunstvoll gewebte Streicher-Klangbild vervielfacht sich peu ä peu, distinkte Holzbläserstimmen nehmen das Thema auf und bilden es solistisch aus. Und einmal mehr ist es die mittlerweile typische Punktierungs- Figur, die auch diesen Satz gemeinschaftlich an die vorhergehenden anbindet. Und noch einmal mehr benutzt Pfitzner die Schlußkadenz, um in den vierten Satz einzubiegen: wiederum eine ländliche Idylle mit einem bukolischen 6 / 8-Takt-Thema in der Manier Smetanas. Die Sologeige wagt eine schüchterne Erinnerung an den 1.Satz, während die rauschenden Skalen auf und ab eine Rückbindung an das Scherzo sind. Die vordergründige Heiterkeit lässt ab Buchstabe T vollends die Zügel schießen: da klingt es dann tatsächlich nach dörfischer Kirmes und schweißtreibendem Tanzboden. Eine neue Pfitzner'sche Handschrift also, virtuoser, schlanker, treffsicherer, auf größtmögliche thematische Klarheit und größtmögliche motivische Substanzgemeinschaft bedacht. Eine alte Pfitzner'sche Handschrift hingegen, was seine aus der Bühnenmusik bekannte Erfindungsgabe der Stimmungs-Stationen angeht. Diese vier Sätze formen musikalische Bilder, denen die theatralischen zu fehlen scheinen: die Eindrücke von Morgenstimmung, Sommernachts- Spuk. Abendrot und Tanzboden- Biederlichkeit drängen sich wie von selbst auf; Pfitzners Musik der "Kleinen Sinfonie" klingt, als wolle sie etwas außerhalb ihrer selbst Liegendes illustrieren, und wo dieses zu Illustrierende nicht vorhanden ist, übertreibt sie die Illustrationen an sich. An Modernität gebricht es seiner Musik in diesem Falle vollkommen, der - wenn man so sagen darf - "tümelnde Ton" wäre als Parodie seiner selbst aufzufassen, würde man nicht Pfitzner als Komponisten kennen, dem die selbstironische Distanz absolut fremd gewesen ist. In dieser Fremdheit liegt das eigentlich Befremdliche der Musik von op. 44: sie beschwört einen Ton, den die Kompositionsgeschichte 1939 längst überwunden und restlos an die Domäne der Kinos abgetreten hatte.
1940, ein Jahr später, wird die Partitur der Sinfonie für großes Orchester op. 46 gedruckt. Pfitzner versieht sie mit der Widmung: "An die Freunde". Es handelt sich um drei Sätze in einem Satz, allerdings sind die drei Partien derart kräftig voneinander unterschieden, dass eine integrale Einsätzigkeit sich nicht herstellt. Schon der erste Satz steht vom Gedanken einer gegenseitigen thematischen Durchdringung ab: nach einem vom Horn exponierten ersten, sehr pathetisch im Bruckner- Tonfall klingenden Thema hebt ein zweites Thema diesen lmponier-Gestus wieder auf; in gemächlichem Rhythmus, in biederer Austerzung, in abgezirkelter periodischer Achttaktigkeit und in pastoraler Instrumentation bringt dieses Thema einen gegenläufigen lyrischen Ton ins Spiel. Pfitzner wechselt hier konsequent in ein kammermusikalisch- durchsichtiges Satzgefüge. Der exponierte Kontrast von Pathos und Lyrismus wird allerdings nicht ausgetragen, sondern nur episodisch fortgesetzt. Dort, wo man den Beginn einer Durchführung ahnt, wird die Abfolge von erstem und zweitem Thema bloß wiederholt; es bleibt beim Wechsel der Stimmungs- Szenerie. Charakterwechsel dann im Adagio, wo sich Pfitzner wieder einmal als vollendeter Erfinder einer melodischen Ausdrucksgestalt erweist: vor einer abgedunkelten Kulisse aus gedämpftem, sordiniertem Streicherglanz entwickelt sich eine weit ausholende, unendliche Melodie. Ein orchestrales "Lied ohne Worte" sozusagen, jedoch mit allen Kennzeichen einer prosaischen Freizügigkeit. Die hervortretenden Klangfarben (Englischhorn und Horn) vervollkommnen den Eindruck einer klagend- elegischen Gesangs-Szene, in der die Septimen- bzw Sextaufschwünge und die zahlreichen Sekundvorhalte ausdrucksprägend sind. Dezent nimmt Pfitzner den harmonischen Beleuchtungswechsel vor; ein allmähliches Hinübergleiten a-Moll / ges-Moll verstärkt den Eindruck des schweifenden Wanderns, dessen Schritt sich irgendwo verliert. Harter Schnitt mit Beginn des Finales: ein stürmischer Jagd-Gestus mit einem fanfarenhaften Dreiklangsthema, welches die vier Hörner schmettern. An zwei Stellen unterbricht Pfitzner den raschen, naiven Bewegungszug: 7 Takte nach L bringt sich das Englischhorn aus dem zweiten Satz mit einer chromatisch fallenden Melodie in Erinnerung, und 14 Takte vor V nimmt das Fagott die bisherige Begleitfigur solistisch auf und formuliert sie zum Tanzcharakter um. Doch dies sind nur Episoden, der Jagd-Gestus setzt sich wieder durch, legt vorübergehend vornehme akademische Blässe auf mit kunstvoll gedrechselten Fugati, um dann ins Schlußgeschmetter zu treiben; hier meldet sich dann auch wieder das pathetische Anfangsthema aus dem ersten Satz zu Wort: das macht dann, zusammen mit dem Signalthema dieses Satzes, ein wahrhaft prunk- und schwungvolles Finish.
Für die Sinfonie op. 46 gilt, was zur "Kleinen Sinfonie" op. 44 gesagt wurde: sie artikuliert sich in Bildern, in szenischen Arrangements. Indem sie mit überlieferten Versatzstücken aus dem Repertoire einer romantischen Tonmalerei arbeitet, tönt sie nach Programmmusik, deren Programm assoziativ im Kopf des Hörers sich von selbst ausbildet, nicht zuletzt unter dem Einfluss eines heute vorangeschrittenen Lernprozesses mit Kinobildern und Kinomusik. Die Stärke der Pfitzner'schen Musik in diesen beiden Sinfonien ist ihre gestische Überdeutlichkeit; sie ist aber im gleichen Atemzug ihre Schwäche: was assoziativ ein Vorzug ist, erweist sich ästhetisch als Mangel. Die Prägnanz der musikalisch gezeichneten Stimmungsbilder machte in der Bühnenmusik zu Ibsens Schauspiel ausgangs des 19. Jahrhunderts noch einen Sinn, denn dort war nicht mehr und nicht weniger zu erfinden als taugliche Funktionsmusik. Man darf getrost darüber erstaunt sein, dass der Studiosus Hans Pfitzner in jungen Jahren handwerklich dieser Aufgabe bereits gewachsen war. Fünfzig Jahre später hingegen scheint er in den Opeta 44 und 46 nicht vom Fleck gekommen zu sein; mehr noch: er ist von einer Entwicklung überrollt worden, welche den musikalischen Fortschritt in den Bereich der Kammermusik verwiesen hat und den ästhetischen Rückschritt in den Bereich der Kinematographie. Genau dort finden wir das rezeptionsgeschichtlich abgesunkene Vokabular wieder, mit welchem Pfitzner aus Gründen, die dunkel bleiben, in diesen beiden Sinfonien arbeitet. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass selbst auf dem Feld der funktionalen Filmmusik Komponisten zu finden sind - zu denken wäre etwa an Bernard Herrmann - welche einen Hans Pfitzner hinsichtlich kompositorischer Risikofreude, fortschrittlichem Material und klangfarblicher Raffinesse in den Schatten stellen. Es erhebt sich also die Frage, warum gerade hier Hans Pfitzner einen betont traditionellen Weg geht, an keiner Stelle auch nur eine Handbreit von der Traditionsspur abweicht und geradezu ängstlich in diesen beiden Sinfonien darauf bedacht zu sein scheint, ein formales wie materiales und ein strukturelles wie klangfarbliches Risiko zu vermeiden. Einen zaghaften Hinweis gibt die Widmung "An die Freunde". Von reiz- und streitbarer Natur, legte er sich mit Gott und der Welt an, vor allem mit der Welt der musikalischen Avantgarde. So heftig er im Tonfall seiner Attacken war, so heftig war er auch in seinen Sympathiebekundungen. Tolerante Gelassenheit war seine Sache nicht; er unterschied seine Zeitgenossen in Freund und Feind. Dieser leicht neurotische Hang zur übertreibenden Parteilichkeit kommt nicht zuletzt in seinem merkwürdigen Faible für ein ebenso merkwürdiges "Deutschtum" zum Ausdruck; auch wohl in der Bereitschaft, 1936 das Amt eines Reichskultursenators zu übernehmen. So fängt denn die Widmung "An die Freunde" in den Anfangsjahren eines Zweiten Weltkriegs an, eigentümlich zu schillern. Ein Hans Pfitzner schreibt in diesen Jahren für die, die ihm wohlgesonnen sind; er schreibt auch für jene, denen er selbst wohlgesonnen sein möchte. Das grenzt ihn einerseits aus dem Kreis wagemutiger kompositorischer Pfadfinder aus. das grenzt ihn andererseits im Kreis reaktionär Gesinnter ein. Die beiden Sinfonien erklären sich damit als klingende Dokumente: nicht im Sinne eines "nationalsozialistischen Realismus", wohl aber im Sinne eines trotzigen Dogmatismus, der sich auf ein sog. "Erbe" verpflichten möchte. Rechnet man die Tatsache hinzu. dass beide Sinfonien vom Kanonendonner des Weltkrieges begleitet werden (den Pfitzner doch wohl auch gehört hat, oder?). so erhärtet sich ein Verdacht: sie scheinen klingende Gegenfiguren zu sein in einer durch und durch ideologischen Weise. Gegenfiguren der gewollten Idylle, der geplanten Innerlichkeit, des gezielten Pathos. Sie ähneln darin jenen Filmen aus jener Zeit, in der nichts "einen Seemann erschüttern" konnte; je grauenvoller der weltpolitische Alltag wurde, desto stärker blendete sich die Welt des Kinos gegen dieses Grauen ab. Pfitzners Sinfonien op. 44 und 46 vollziehen genau diese Abblendung auf ihre Weise mit, wobei man im Nachhinein nicht entscheiden kann, ob das Motiv für solche sinfonischen Illusionen staatsparteilicher Opportunismus war oder nur die Flucht eines von der Weltpolitik verstörten Hans Pfitzner in den selbstgeschaffenen Traum von einer Welt, welche nach ländlicher Geruhsamkeit und Olympischen Spielen tönt. Dies zu entscheiden, steht einer Nachwelt schlecht zu Gesicht. Wohl aber ist es ein Gebot der Redlichkeit, von der absoluten Gleichgültigkeit einer Musik zu sprechen, deren Beschwörung des Vorgestern eine Verschwörung gegen das Heute ihrer Entstehungszeit zu sein scheint. Von einer Musik,-die sich gewissermaßen rücksichtslos abkapselte, sei's aus naiver Beschwichtigung, sei's aus naiver Erfolgshoffnung; die sich abkapselte wie die harmlose Wunderwelt des Kinos aus den beginnenden Vierziger Jahren. Es scheint also mehr als zufällig zu sein, dass Hans Pfitzner mit dem Ton seiner Sinfonien op. 44 und 46 genau auf diese cineastische Beschwichtigungsformel einschwenkt und nochmals, 50 Jahre nach dem "Fest auf Solhaug", eine Musik für die "Bühne" schreibt: die Bühne, auf der man immer wieder die Vision "Durch Nacht zum Licht" inszeniert. lllustrationsmusik. lllustrationsmusik obendrein. Auch das ein Kapitel in der Geschichte des Hans Pfitzner; ein Kapitel der entweder dreist unterschlagenen oder aber der änqstlich unterdrückten Wahrheit - doch wer will das entscheiden?
Wir überspringen 50 Jahre. 1939 schreibt Hans Pfitzner die "Kleine Sinfonie" in vier Sätzen op. 44. Hat sich an seiner Handschrift etwas verändert? Steht auch mit der ein Jahr später geschriebenen Sinfonie für großes Orchester op. 46 (1940) ein neuer Hans Pfitzner vor Augen und Ohren? Ja und nein. Ja insofern, als sich das Satzbild der "Kleinen Sinfonie" weit schlanker und durchsichtiger darstellt als in der farbendurchdränkten Bühnenmusik. Der Streicher-Chor klingt nun homogener, die Bläserstimmen, vor allem die Holzbläser-Register, werden solistisch beigemischt und klingen manierlich abgehoben. Homogenität auch in der Konzeption von Themen und Gegenthemen: das Kopfthema des ersten Satzes ist bestimmt von der rhythmischen Figur, welche im Seitenthema ebenfalls wiederkehrt. Haupt- und Nebeneinfall unterscheiden sich nicht substanziell, sondern nur farblich: das erste Thema gehört den Streichern, das zweite den Bläsern. Was wird daraus? Keine Diskussion. keine widersprüchliche Auseinandersetzung, sondern ein einheitlicher Grundzug des musikalischen Charakters, was durch die allmähliche Vorbereitung des nächstfolgenden Themas in der vorhergehenden Überleitung unterstrichen wird. Folgt eine Reprise, die keine ist, sondern nur noch einmal den alles bestimmenden thematischen Grundeinfall in Erinnerung bringt. lm Tonfall und in der auf Annäherung bedachten thematischen Arbeit, die den Kontrast. den expressiven Bruch und den rhetorischen Widerspruch tunlichst vermeidet, entsteht der Eindruck einer friedlichen Idylle, eines gemütvoll-gemütlichen Musizierens; alles ist auf Fluss, auf harmonisches Wechselspiel eingestellt, jede Phrase gibt der anderen sozusagen die freundliche Hand. Dieser Eindruck bleibt bestehen. lm zweiten Satz, einem 6 / 8-Takt-Scherzo, dominiert ein prägnantes Trompeten-Signal. dominieren energische, oft unisono geführte rasche Skalenbewegungen auf- und abwärts. Ein sangliches Gegenthema will sich behaupten, bleibt allerdings ohne Gewicht. Was vordringt, ist unbekümmerte Mendelssohn- Leichtigkeit, ähnlich dem Scherzo für Orchester aus dem Jahre 1988. Und wieder diese beharrlich-leichtfüßige Rhythmusfigur die an den ersten Satz erinnert. Der Satz schließt, wie das für Pfitzner typisch ist, mit einer kurzen Kadenz, die in den elegischen dritten Satz mündet. Den friedvollen Ton stiftet ein dicht gewebter Streicher-Chor, den ein Thema beherrscht, das entfernt an das vierte der "Vier letzten Lieder" von Richard Strauss erinnert. Dieses kunstvoll gewebte Streicher-Klangbild vervielfacht sich peu ä peu, distinkte Holzbläserstimmen nehmen das Thema auf und bilden es solistisch aus. Und einmal mehr ist es die mittlerweile typische Punktierungs- Figur, die auch diesen Satz gemeinschaftlich an die vorhergehenden anbindet. Und noch einmal mehr benutzt Pfitzner die Schlußkadenz, um in den vierten Satz einzubiegen: wiederum eine ländliche Idylle mit einem bukolischen 6 / 8-Takt-Thema in der Manier Smetanas. Die Sologeige wagt eine schüchterne Erinnerung an den 1.Satz, während die rauschenden Skalen auf und ab eine Rückbindung an das Scherzo sind. Die vordergründige Heiterkeit lässt ab Buchstabe T vollends die Zügel schießen: da klingt es dann tatsächlich nach dörfischer Kirmes und schweißtreibendem Tanzboden. Eine neue Pfitzner'sche Handschrift also, virtuoser, schlanker, treffsicherer, auf größtmögliche thematische Klarheit und größtmögliche motivische Substanzgemeinschaft bedacht. Eine alte Pfitzner'sche Handschrift hingegen, was seine aus der Bühnenmusik bekannte Erfindungsgabe der Stimmungs-Stationen angeht. Diese vier Sätze formen musikalische Bilder, denen die theatralischen zu fehlen scheinen: die Eindrücke von Morgenstimmung, Sommernachts- Spuk. Abendrot und Tanzboden- Biederlichkeit drängen sich wie von selbst auf; Pfitzners Musik der "Kleinen Sinfonie" klingt, als wolle sie etwas außerhalb ihrer selbst Liegendes illustrieren, und wo dieses zu Illustrierende nicht vorhanden ist, übertreibt sie die Illustrationen an sich. An Modernität gebricht es seiner Musik in diesem Falle vollkommen, der - wenn man so sagen darf - "tümelnde Ton" wäre als Parodie seiner selbst aufzufassen, würde man nicht Pfitzner als Komponisten kennen, dem die selbstironische Distanz absolut fremd gewesen ist. In dieser Fremdheit liegt das eigentlich Befremdliche der Musik von op. 44: sie beschwört einen Ton, den die Kompositionsgeschichte 1939 längst überwunden und restlos an die Domäne der Kinos abgetreten hatte.
1940, ein Jahr später, wird die Partitur der Sinfonie für großes Orchester op. 46 gedruckt. Pfitzner versieht sie mit der Widmung: "An die Freunde". Es handelt sich um drei Sätze in einem Satz, allerdings sind die drei Partien derart kräftig voneinander unterschieden, dass eine integrale Einsätzigkeit sich nicht herstellt. Schon der erste Satz steht vom Gedanken einer gegenseitigen thematischen Durchdringung ab: nach einem vom Horn exponierten ersten, sehr pathetisch im Bruckner- Tonfall klingenden Thema hebt ein zweites Thema diesen lmponier-Gestus wieder auf; in gemächlichem Rhythmus, in biederer Austerzung, in abgezirkelter periodischer Achttaktigkeit und in pastoraler Instrumentation bringt dieses Thema einen gegenläufigen lyrischen Ton ins Spiel. Pfitzner wechselt hier konsequent in ein kammermusikalisch- durchsichtiges Satzgefüge. Der exponierte Kontrast von Pathos und Lyrismus wird allerdings nicht ausgetragen, sondern nur episodisch fortgesetzt. Dort, wo man den Beginn einer Durchführung ahnt, wird die Abfolge von erstem und zweitem Thema bloß wiederholt; es bleibt beim Wechsel der Stimmungs- Szenerie. Charakterwechsel dann im Adagio, wo sich Pfitzner wieder einmal als vollendeter Erfinder einer melodischen Ausdrucksgestalt erweist: vor einer abgedunkelten Kulisse aus gedämpftem, sordiniertem Streicherglanz entwickelt sich eine weit ausholende, unendliche Melodie. Ein orchestrales "Lied ohne Worte" sozusagen, jedoch mit allen Kennzeichen einer prosaischen Freizügigkeit. Die hervortretenden Klangfarben (Englischhorn und Horn) vervollkommnen den Eindruck einer klagend- elegischen Gesangs-Szene, in der die Septimen- bzw Sextaufschwünge und die zahlreichen Sekundvorhalte ausdrucksprägend sind. Dezent nimmt Pfitzner den harmonischen Beleuchtungswechsel vor; ein allmähliches Hinübergleiten a-Moll / ges-Moll verstärkt den Eindruck des schweifenden Wanderns, dessen Schritt sich irgendwo verliert. Harter Schnitt mit Beginn des Finales: ein stürmischer Jagd-Gestus mit einem fanfarenhaften Dreiklangsthema, welches die vier Hörner schmettern. An zwei Stellen unterbricht Pfitzner den raschen, naiven Bewegungszug: 7 Takte nach L bringt sich das Englischhorn aus dem zweiten Satz mit einer chromatisch fallenden Melodie in Erinnerung, und 14 Takte vor V nimmt das Fagott die bisherige Begleitfigur solistisch auf und formuliert sie zum Tanzcharakter um. Doch dies sind nur Episoden, der Jagd-Gestus setzt sich wieder durch, legt vorübergehend vornehme akademische Blässe auf mit kunstvoll gedrechselten Fugati, um dann ins Schlußgeschmetter zu treiben; hier meldet sich dann auch wieder das pathetische Anfangsthema aus dem ersten Satz zu Wort: das macht dann, zusammen mit dem Signalthema dieses Satzes, ein wahrhaft prunk- und schwungvolles Finish.
Für die Sinfonie op. 46 gilt, was zur "Kleinen Sinfonie" op. 44 gesagt wurde: sie artikuliert sich in Bildern, in szenischen Arrangements. Indem sie mit überlieferten Versatzstücken aus dem Repertoire einer romantischen Tonmalerei arbeitet, tönt sie nach Programmmusik, deren Programm assoziativ im Kopf des Hörers sich von selbst ausbildet, nicht zuletzt unter dem Einfluss eines heute vorangeschrittenen Lernprozesses mit Kinobildern und Kinomusik. Die Stärke der Pfitzner'schen Musik in diesen beiden Sinfonien ist ihre gestische Überdeutlichkeit; sie ist aber im gleichen Atemzug ihre Schwäche: was assoziativ ein Vorzug ist, erweist sich ästhetisch als Mangel. Die Prägnanz der musikalisch gezeichneten Stimmungsbilder machte in der Bühnenmusik zu Ibsens Schauspiel ausgangs des 19. Jahrhunderts noch einen Sinn, denn dort war nicht mehr und nicht weniger zu erfinden als taugliche Funktionsmusik. Man darf getrost darüber erstaunt sein, dass der Studiosus Hans Pfitzner in jungen Jahren handwerklich dieser Aufgabe bereits gewachsen war. Fünfzig Jahre später hingegen scheint er in den Opeta 44 und 46 nicht vom Fleck gekommen zu sein; mehr noch: er ist von einer Entwicklung überrollt worden, welche den musikalischen Fortschritt in den Bereich der Kammermusik verwiesen hat und den ästhetischen Rückschritt in den Bereich der Kinematographie. Genau dort finden wir das rezeptionsgeschichtlich abgesunkene Vokabular wieder, mit welchem Pfitzner aus Gründen, die dunkel bleiben, in diesen beiden Sinfonien arbeitet. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass selbst auf dem Feld der funktionalen Filmmusik Komponisten zu finden sind - zu denken wäre etwa an Bernard Herrmann - welche einen Hans Pfitzner hinsichtlich kompositorischer Risikofreude, fortschrittlichem Material und klangfarblicher Raffinesse in den Schatten stellen. Es erhebt sich also die Frage, warum gerade hier Hans Pfitzner einen betont traditionellen Weg geht, an keiner Stelle auch nur eine Handbreit von der Traditionsspur abweicht und geradezu ängstlich in diesen beiden Sinfonien darauf bedacht zu sein scheint, ein formales wie materiales und ein strukturelles wie klangfarbliches Risiko zu vermeiden. Einen zaghaften Hinweis gibt die Widmung "An die Freunde". Von reiz- und streitbarer Natur, legte er sich mit Gott und der Welt an, vor allem mit der Welt der musikalischen Avantgarde. So heftig er im Tonfall seiner Attacken war, so heftig war er auch in seinen Sympathiebekundungen. Tolerante Gelassenheit war seine Sache nicht; er unterschied seine Zeitgenossen in Freund und Feind. Dieser leicht neurotische Hang zur übertreibenden Parteilichkeit kommt nicht zuletzt in seinem merkwürdigen Faible für ein ebenso merkwürdiges "Deutschtum" zum Ausdruck; auch wohl in der Bereitschaft, 1936 das Amt eines Reichskultursenators zu übernehmen. So fängt denn die Widmung "An die Freunde" in den Anfangsjahren eines Zweiten Weltkriegs an, eigentümlich zu schillern. Ein Hans Pfitzner schreibt in diesen Jahren für die, die ihm wohlgesonnen sind; er schreibt auch für jene, denen er selbst wohlgesonnen sein möchte. Das grenzt ihn einerseits aus dem Kreis wagemutiger kompositorischer Pfadfinder aus. das grenzt ihn andererseits im Kreis reaktionär Gesinnter ein. Die beiden Sinfonien erklären sich damit als klingende Dokumente: nicht im Sinne eines "nationalsozialistischen Realismus", wohl aber im Sinne eines trotzigen Dogmatismus, der sich auf ein sog. "Erbe" verpflichten möchte. Rechnet man die Tatsache hinzu. dass beide Sinfonien vom Kanonendonner des Weltkrieges begleitet werden (den Pfitzner doch wohl auch gehört hat, oder?). so erhärtet sich ein Verdacht: sie scheinen klingende Gegenfiguren zu sein in einer durch und durch ideologischen Weise. Gegenfiguren der gewollten Idylle, der geplanten Innerlichkeit, des gezielten Pathos. Sie ähneln darin jenen Filmen aus jener Zeit, in der nichts "einen Seemann erschüttern" konnte; je grauenvoller der weltpolitische Alltag wurde, desto stärker blendete sich die Welt des Kinos gegen dieses Grauen ab. Pfitzners Sinfonien op. 44 und 46 vollziehen genau diese Abblendung auf ihre Weise mit, wobei man im Nachhinein nicht entscheiden kann, ob das Motiv für solche sinfonischen Illusionen staatsparteilicher Opportunismus war oder nur die Flucht eines von der Weltpolitik verstörten Hans Pfitzner in den selbstgeschaffenen Traum von einer Welt, welche nach ländlicher Geruhsamkeit und Olympischen Spielen tönt. Dies zu entscheiden, steht einer Nachwelt schlecht zu Gesicht. Wohl aber ist es ein Gebot der Redlichkeit, von der absoluten Gleichgültigkeit einer Musik zu sprechen, deren Beschwörung des Vorgestern eine Verschwörung gegen das Heute ihrer Entstehungszeit zu sein scheint. Von einer Musik,-die sich gewissermaßen rücksichtslos abkapselte, sei's aus naiver Beschwichtigung, sei's aus naiver Erfolgshoffnung; die sich abkapselte wie die harmlose Wunderwelt des Kinos aus den beginnenden Vierziger Jahren. Es scheint also mehr als zufällig zu sein, dass Hans Pfitzner mit dem Ton seiner Sinfonien op. 44 und 46 genau auf diese cineastische Beschwichtigungsformel einschwenkt und nochmals, 50 Jahre nach dem "Fest auf Solhaug", eine Musik für die "Bühne" schreibt: die Bühne, auf der man immer wieder die Vision "Durch Nacht zum Licht" inszeniert. lllustrationsmusik. lllustrationsmusik obendrein. Auch das ein Kapitel in der Geschichte des Hans Pfitzner; ein Kapitel der entweder dreist unterschlagenen oder aber der änqstlich unterdrückten Wahrheit - doch wer will das entscheiden?
Rezensionen
Frankfurter Rundschau v.27.4.91: "Die ausgedehnte Schauspielmusik "Fest auf Solhaug" steht für die feurige Genialität und die frappierende frühe Meisterschaft des noch ganz jungen Pfitzner ein." Fanfare (USA) 8/91: "Die Symphonie op.44 ist eine von Pfitzners schönsten Schöpfungen."-
Tracklisting
-
Details
-
Mitwirkende
Disk 1 von 1 (CD)
Kleine Sinfonie op. 44
-
1 1. Gemächlich
-
2 2. Allegro
-
3 3. Adagio
-
4 4. Heiter bewegt (Allegretto)
Sinfonie op. 46
-
5 1. Allegro moderato
-
6 2. Sehr langsam (Adagio)
-
7 3. Presto
Das Fest auf Solhaug
-
8 1. Vorspiel 1
-
9 2. Vorspiel 2
-
10 3. Vorspiel 3